Do-it-yourself und do-it-together
Interview zur partizipativen Produktion „Newsroom“ und zum neuen Podcast-Club
Marielle Schavan vom Theaterkollektiv Henrike Iglesias, Anne Mahlow, Leitung des Podcast-Clubs, und Irina-Simona Bârcă, Leitung der Abteilung Künstlerische Vermittlung und Partizipation, wollen bei jungen Menschen das Interesse für Nachrichten wecken und ganz nebenbei mehr Medienkompetenz vermitteln. Das funktioniert ganz praktisch und lebensnah – mithilfe von partizipativen Produktionen.
Zusammen mit Arya Hector sprachen sie im Januar über die Probleme der heutigen Nachrichtenflut und über die Relevanz von Jugendprojekten, bei denen alle Beteiligten das Gefühl bekommen, tatsächlich etwas bewirken zu können.
Zusammen mit Arya Hector sprachen sie im Januar über die Probleme der heutigen Nachrichtenflut und über die Relevanz von Jugendprojekten, bei denen alle Beteiligten das Gefühl bekommen, tatsächlich etwas bewirken zu können.
ARYA Von der täglichen Informationsflut, die sich vom Analogen immer stärker ins Digitale verschiebt, fühlen sich viele Menschen überfordert. Warum sollten gerade Heranwachsende im Umgang mit Medien sensibilisiert werden?
MARIELLE Weil sie permanent davon umgeben sind und nicht davon ferngehalten werden können. Deswegen sollten wir einen Weg finden, den richtigen Umgang damit zu erlernen: Wie kann ich mich auch davon abgrenzen, wenn ich das möchte? Wie kann ich erkennen, ob etwas fake oder real ist? Wir möchten den Heranwachsenden eine gewisse Medienkompetenz vermitteln.
ANNE Ich würde sagen, dass nicht nur Heranwachsende, sondern auch Erwachsene für eine kritische Auseinandersetzung mit Medien sensibilisiert werden sollten und wir dabei sogar von Jugendlichen lernen können. Ich nehme wahr, dass einige junge Erwachsene mit Hilfe von Angeboten zur Medienkompetenz in Beratungseinrichtungen, Schulen etc. die sozialen Medien sogar als empowernden Ort erleben können und sich fragen, wie sie ihn selbst gestalten können. Es braucht mehr dieser Angebote für Jung und Alt.
ARYA Wie konsumieren junge Menschen heutzutage denn Medien?
MARIELLE In unseren Proben zu „Newsroom“ haben wir Gespräche mit den Teilnehmenden dazu geführt, aber auch diverse Studien zeigen: Jugendliche konsumieren immer weniger Nachrichten aus traditionellen Medien, sondern viel mehr von sozialen Medien, wie Instagram und TikTok. Teilweise schauen sie auch mit ihren Eltern Nachrichten. Auch das „Berliner Fenster“ in den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde genannt, aber nur die allerwenigsten lesen tatsächlich Print- oder Onlineartikel oder hören noch Radio.
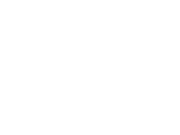
IRINA Die #UseTheNews-Studie hat ergeben, dass Jugendliche, die sowieso Interesse an Nachrichten haben, meist auch auf qualitative journalistische Angebote zurückgreifen – und zwar nicht nur über soziale Medien. Jugendliche, die aber kein Interesse haben, holen sich ihre Informationen über Social Media und Influencer*innen. Dabei gibt es natürlich auch Influencer*innen, die sehr gut recherchierte Inhalte produzieren, aber halt auch welche, die Falschinformationen verbreiten und Meinungen manipulieren. Gerade in rechtsextremen Kreisen wird über Social Media extrem viel junge Wähler*innenschaft mobilisiert, wie wir bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gesehen haben.
MARIELLE Gleichzeitig hat beispielsweise die AfD in den sozialen Medien wie TikTok den stärksten und präsentesten Auftritt. Das gibt dann natürlich ein verkürztes Bild, wenn andere Parteien hier kaum bis gar nicht vertreten sind. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Wahlen ist das ein Vorteil, der sehr schwierig ist.
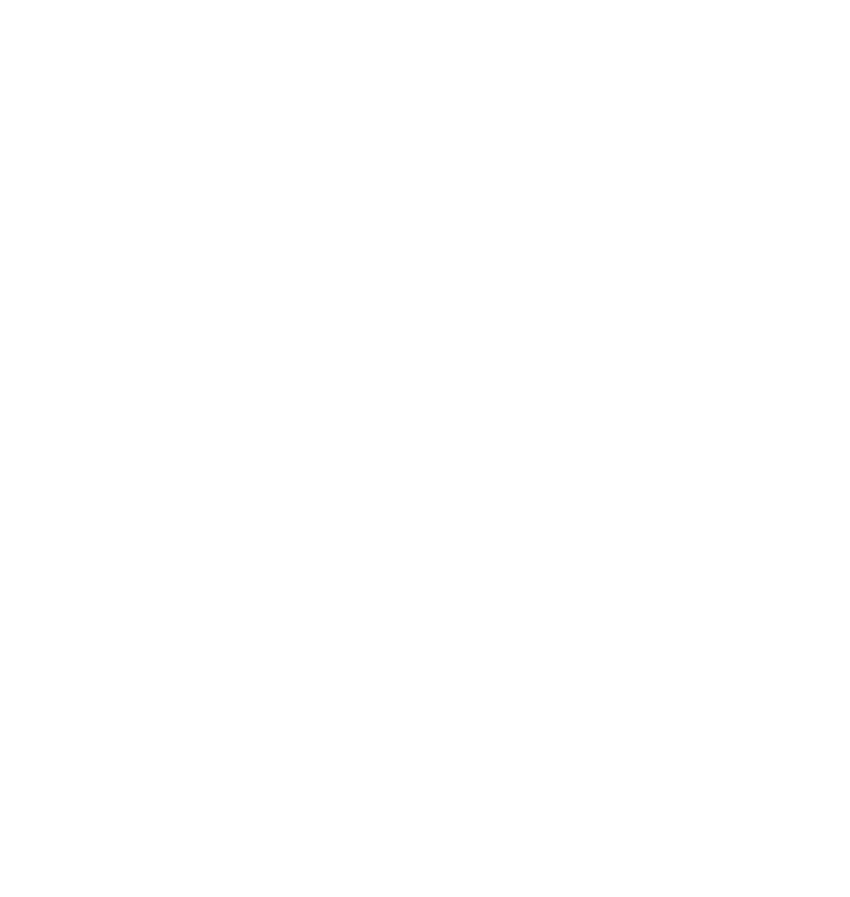
ANNE Gleichzeitig gibt es in meinen Augen aktuell in der medialen Debatte auch eine Diskrepanz – sei es auf Social Media, in Talkrunden oder klassischen Berichterstattungen: Zwischen den vielseitigen Themen, die gerade junge Menschen kurz vor der Wahl beschäftigen, wie Frieden, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz oder Wirtschaft – und Themen, die einen unverhältnismäßigen Fokus bekommen, wie Migration. Und die auf diese Weise abseits von Statistik und Faktenchecks für eine verzerrte Wahrnehmung sorgen und populistische Debatten befeuern.
ARYA Warum sind gerade Rechtsextreme in den sozialen Medien so erfolgreich?
IRINA Solche Kreise arbeiten häufig komplett postfaktisch und es geht gar nicht mehr darum, wahre Informationen zu vermitteln und sich auf Fakten zu berufen. Stattdessen schneidet man sie sich so zurecht, wie es gerade passt, und macht unsägliche Aussagen. Das wird in den Medien natürlich weiter verbreitet und kommuniziert. Ich glaube, als junge Person ist es extrem schwierig, sich heutzutage in so einer Nachrichtenflut zu orientieren; vor allem wenn man zu Hause oder in der Schule dabei keine direkte Unterstützung bekommt.
MARIELLE Auch viele Politiker*innen – wir sehen es ja gerade in den USA mit Trump – leben dieses Postfaktische mittlerweile aus. Sie verbreiten verkürzte Informationen, die natürlich erst einmal viel einfacher zu verstehen sind. Hier wird ganz bewusst mit Effekten, Emotionalisierung und Popularisierung gearbeitet. Da ist es selbstverständlich schwierig, überhaupt noch an beispielsweise gut recherchierte Nachrichtenmeldungen zu glauben, weil überall eigentlich suggeriert wird, dass es darum gar nicht mehr geht.
ANNE Rechte Parteien, wie die AfD, verstehen es sich mit Effekthascherei und Populismus in Szene zu setzen und sind auf Social Media sehr aktiv. Bis auf die Linkspartei haben es die anderen Parteien verschlafen, diesen Raum für sich ausreichend zu nutzen, ihre eigenen Themen zu setzen und damit diese junge Wähler*innenschaft anzusprechen. Was passiert, wenn man das tut, junge Menschen adressiert, Vorschläge zu ihren Fragen nach Bildung, sozialer Gerechtigkeit, Klimaschutz etc. macht und sie einbezieht, kann man an den aktuellen Umfragen der U18-Bundestagswahl sehen, bei denen die Linke mit 20,8% mit Abstand gewinnt. Auch bei den Parteipräferenzen der 18-29-Jährigen liegt sie laut einer Forsa-Umfrage mit 19% vorn, gleichauf mit den Grünen.
ARYA Medienkompetenz können Jugendliche jetzt sowohl in der interaktiven Nachrichtensendung „Newsroom“, als auch im Podcast-Club erwerben. Hierbei handelt es sich um zwei partizipative Projekte. Welche Rolle spielt das Thema Partizipation in diesem Kontext?
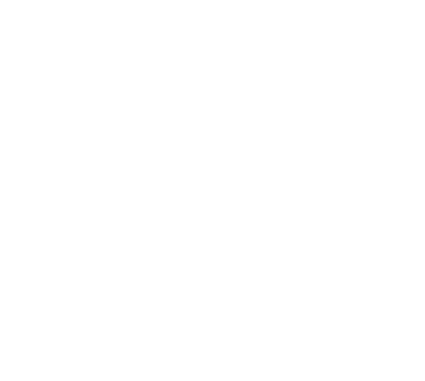
MARIELLE Was die Studien ergeben und auch in den Gesprächen mit den Teilnehmenden von „Newsroom“ immer wieder aufkommt, ist ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit in Bezug auf Medienkonsum. Viele fühlen sich frustriert und denken, man könne ohnehin nichts ändern, und wollen sich daher lieber gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Eher traditionelle Theaterformen, in denen beispielsweise frontal erklärt werden könnte, wie Nachrichten konsumiert werden wollen, könnten dieses Gefühl im schlimmsten Fall reproduzieren. Wir wünschen uns, dass die Zuschauer*innen das Gefühl haben, dass die Themen und die Art, wie sie auf die Bühne gebracht werden, etwas mit ihnen machen.
Wir stellen die Gefühle und Fragen junger Menschen zu den Themen ganz zentral in den Vordergrund. Es geht darum, was wir konkret machen können, wie wir unsere Handlungsfähigkeit entdecken oder wiederfinden und damit experimentieren können. Ziel unserer künstlerischen Arbeit ist es, dass Jugendlichen bewusst wird, dass sie durchaus eine Form von Handlungsfähigkeit besitzen, die sicherlich eingeschränkt, aber trotzdem vorhanden und wichtig ist.
ANNE Es ist sowohl wichtig für Jugendliche Tools zu haben, um Medien kritisch zu hinterfragen, als auch selbst aktiv zu werden. Ein Schlüssel für mich ist hierbei die gemeinsame Aktion: Das Gefühl zu haben nicht allein zu sein mit all den Themen, sich zu trauen nachzufragen, in die gemeinsame Auseinandersetzung zu gehen und zu merken, was es bedeuten kann, solidarisch miteinander aktiv zu werden.
IRINA Ich halte es für sehr wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche bestmöglich in die Inhalte und in dem, was wir machen, partizipativ einbringen. Gleichzeitig bieten wir ihnen aber auch so viel Rahmen, wie sie eben brauchen. Ein Angebot ohne jeglichen Rahmen kann sonst auch sehr überfordernd sein. Deswegen gibt es eher Reize und Fragen von unserer Seite an die Teilnehmenden, mit denen wir versuchen, sie zu beteiligen und auch möglichst nach den eigenen Interessen in den Projekten arbeiten zu lassen.
ARYA Den eigenen Interessen in einem gemeinsamen Rahmen können Jugendliche im Podcast-Club nachgehen. Was erwartet die Teilnehmenden hier?
IRINA Grundidee vom Podcast-Club ist es, gemeinsam einen Podcast zu konzipieren, zu gestalten und zu moderieren. Inspiriert wurden wir von DT64, einem Jugendprogramm des DDR-Rundfunks. Und weil sich viele junge Leute heutzutage über Podcasts informieren, haben wir uns für dieses Medium entschieden.
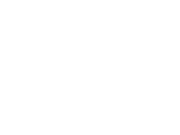
ANNE DT64, das Jugendradio der DDR, war ein wesentliches Element der Jugendkultur in Ostdeutschland. 1964 gegründet, bekam das Jugendprogramm 1986 einen eigenen Sender, bei dem junge Erwachsene, wie Jens Riewa, Susanne Daubner, Marion Brasch selbst aktiv wurden, recherchierten, moderierten. Marion Brasch sagte mal: „In der Wendezeit wurde DT64 unglaublich wichtig, weil wir ja nicht mehr wussten als die jungen Leute im Land. Wir waren immer auf Augenhöhe. […] Wir haben da auch eine Form der Anarchie gelebt, waren ständig als Reporter*innen draußen unterwegs und haben alles begleitet, wir haben mit den Leuten gesprochen, was sie denken, was sie hoffen, was sie wollen. […] Wir haben ein Radio gemacht, was es vorher noch nie gegeben hatte und was es auch danach so nicht mehr geben sollte.“ Gemeinsam mit den Jugendlichen wollen wir auf den Spuren von DT64 ein eigenes Podcast-Format entwickeln, das sich ausgehend von der Wendezeit mit ihren Themen auseinandersetzt und Brücken ins Heute schlägt.
IRINA Thematisch wollen wir uns im Podcast mit der Wendezeit beschäftigen. Umfragen und Berichte (↗ mehr erfahren) belegen, dass die Wende bei jungen Menschen leider nicht unbedingt ein beliebtes Thema ist, dabei ist es extrem vielseitig. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen animieren, selbst nachzuforschen. Was ist in dieser Zeit alles Interessantes passiert? Wie guckt man von heute auf diese Zeit zurück und was ist davon heute noch relevant?
ANNE Hierfür sind wir selbst unterwegs, recherchieren, machen Exkursionen in Archive, treffen Personen, die von dieser Zeit und ihren Erfahrungen berichten. Neben der Frage mit welchen Mitteln wir einen interessanten Podcast gestalten können, ist uns eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Wende, die eine Zäsur in der Geschichte markiert, wichtig. Wir wollen uns mit den Fragen beschäftigen: Wie kann man diese Ausnahmesituation der Wendezeit einordnen, was hat sie für wen bedeutet und wie beeinflusst sie unsere heutige Gesellschaft? Welche Verbindungen hat diese Zeit mit den Jugendlichen von heute und welche Ausnahmezustände kennen sie noch?
IRINA Aktuell sammeln wir, zusammen mit den Kindern und Jugendlichen, Themen und Gäste, mit denen wir sprechen wollen. Insgesamt sollen dann so – begleitend zu einer Produktion in der kommenden Spielzeit – mehrere Folgen entstehen.
ANNE Ausgehend von der Wendezeit wird sich jede Podcast-Folge einem spezifischen Schwerpunkt und Thema widmen. Die Redaktion der Folgen gestalten die Jugendlichen gemeinsam, sie überlegen, wen sie interviewen und welchen Perspektiven sie Gehör verschaffen wollen.
ARYA Wie ist es mit der Interaktivität bei „Newsroom“? Wie werden Teilnehmende und Publikum hier einbezogen?
MARIELLE Grundidee von „Newsroom“ ist es, dass hier im Laufe des Stücks eine Nachrichtensendung live auf der Bühne entsteht, in denen um die zehn Performer*innen arbeiten, Nachrichten produzieren und herstellen und das mithilfe von Live-Video. Das Publikum kann sich mithilfe seiner Smartphones konkret an der Sendung beteiligen. So können wir dann dem Publikum Text, aber auch Bilder direkt auf ihre Smartphones schicken, aber eben auch umgekehrt. Auf diese Weise entsteht dann ganz kollaborativ zwischen Publikum und Performer*innen eine Nachrichten-Show.

ARYA Gibt es hier, wie beim Podcast-Club auch bestimmte Themen, die in der Nachrichtensendung aufgegriffen werden?
MARIELLE Ja, hierbei arbeiten wir in drei Phasen. In der ersten Phase geht es um Nachrichtenkonsum. Wie wir gerade besprochen haben: Was für Fragen wirft das Thema auf? Die zweite Phase ist eben Nachrichten selbst zu kreieren. Also der wirkliche Versuch, ganz nach dem Do-It-Yourself-Prinzip eine eigene Show auf die Beine zu stellen – also so ähnlich wie auch beim Podcast. In der dritten Phase versuchen wir, zusammen mit den Teilnehmenden, zu überlegen, wie wir das Ganze neu angehen könnten. Welche alternativen Formen gibt es, aber auch, was erhoffen wir uns für die Zukunft?
ARYA Woher nehmt ihr die ganze Expertise? Werden auch mal Gäste dazu geladen?
MARIELLE Wir laden dazu verschiedene Expert*innen ein, die wiederum einen bestimmten Themenfokus mitbringen. Beispielsweise hatten wir eine Journalistin da, die sich viel mit TikTok beschäftigt, und jemanden, der zu Aktivismus auf Social Media forscht. Anhand solcher Themen hangeln wir uns dann an den drei Phasen entlang, wobei wir aber immer auch noch Raum für die Teilnehmenden geben. So können diese auch selbst Themen, die ihnen wichtig sind, miteinbringen.
ANNE Die Jugendlichen selbst bringen schon Expertise und auch ein großes Interesse für Podcasts und Geschichte mit – es wird aber auch Gäste geben. Als Reporter*innen des Podcast-Clubs werden die Jugendlichen selbst Expert*innen verschiedener Perspektiven, Alter und Professionen treffen und sie zur Wendezeit befragen.
ARYA Marielle hat gerade den Begriff ‚Do-It-Yourself‘ erwähnt. Selbst aktiv zu werden, zu experimentieren und etwas Eigenes zu erschaffen, ist für die Kinder und Jugendlichen in beiden Projekten von zentraler Bedeutung. Welche Lernprozesse erhofft ihr damit in Gang zu setzen?
IRINA Selbstwirksamkeit. Unser Ziel ist, dass die jungen Menschen aus dieser, sich teils ohnmächtig anfühlenden, konsumierenden Haltung herauskommen und vielmehr eine eher produzierende Haltung einnehmen. Sie lernen bei uns, dass Medien nicht etwas Abstraktes sind, das irgendjemand für andere produziert und das nichts mit einem selbst zu tun hat. Stattdessen kann man am öffentlichen Diskurs teilnehmen, indem man selbst etwas darüber macht, zum Beispiel einen Podcast. Indem ich selbst etwas produziere und meine eigenen Inhalte und Fragen einbringe. Denn die spielen eine Rolle!
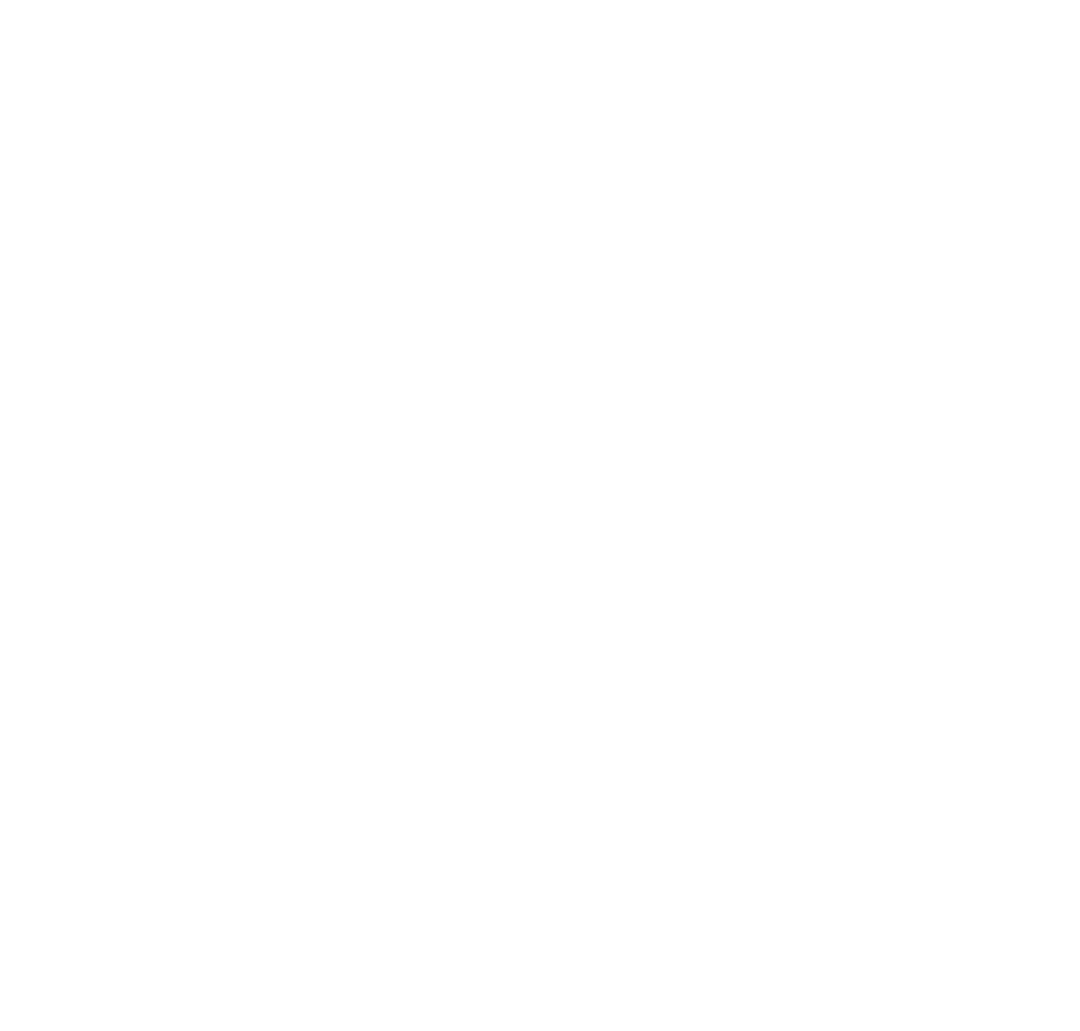
ANNE Ich denke, dass es dabei sowohl um Lern-, als auch um Verlernprozesse geht: Verlernen, dass man den Medien ausgeliefert ist und ihnen ohnmächtig gegenübersteht — und Lernen offen auf Menschen zuzugehen, sich immer wieder auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, sich eine Meinung zu bilden und sich selbst als aktiver Teil der Gesellschaft zu betrachten, die man mitgestalten kann. Im besten Fall tut man das gemeinsam, schließt sich zusammen und setzt sich zusammen damit auseinander: Was wollen wir zum Diskurs beitragen? Welche Themen sind für uns relevant – was wollen wir nicht akzeptieren? Wie wollen wir uns engagieren und aktiv unsere Stimme einbringen, um diese Gesellschaft zu gestalten?
MARIELLE Ich würde mir wünschen, dass Zuschauer*innen mit einem guten Gefühl oder einer Liste von Ideen nach Hause gehen: Was könnte ich machen? Wie könnte ich mich einbringen? Was sind meine Möglichkeiten? Also das Gefühl, konkrete Dinge unternehmen zu können, um sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Denn letztendlich dienen Nachrichten ja genau diesem Zweck, am politischen Geschehen teilzunehmen.
ARYA Dabei ändert sich nicht nur das Gefühl, selbst Teil der Gesellschaft und des politischen Geschehens zu sein, sondern bestimmt auch die Art und Weise, wie man Nachrichten rezipiert.
MARIELLE Definitiv! Diese ganzen Prozesse der Nachrichtenproduktion, die die Teilnehmenden sich bei uns aneignen und einverleiben und die sonst eher außenstehend betrachtet werden, bringen auf jeden Fall die Chance mit sich, Nachrichten ganz anders analysieren zu können. Wenn ich weiß, aus welchen Bestandteilen ein Nachrichtenbeitrag besteht und welche Entscheidungen hier getroffen wurden, kann ich das auch in anderen Beiträgen viel klarer erkennen. Ganz konkret sehe ich dann beispielsweise, welche Bilder mit welchen Überschriften zusammengefügt werden oder mit was für einem Auftritt eine Moderatorin vor die Kamera tritt und in was für einem Ton sie dabei spricht. Diese ganzen Bestandteile zu erkennen und zu analysieren, hilft auch dabei, bestimmte Meldungen zu hinterfragen. Stimme ich beispielsweise damit überein oder finde ich das teilweise problematisch?
ANNE Außerdem wird durch diese Auseinandersetzung ein ganz persönlicher Zusammenhang zwischen den Rezipient*innen und dem gesellschaftlichen und politischen Geschehen aufgemacht. Die Nachrichten sind dann nicht einfach etwas, was losgelöst von mir in der Flimmerkiste oder auf dem Display läuft, sondern was Auswirkungen hat für mich, meine Umwelt, die Gesellschaft. Das stellt die Frage danach, wie ich erkenne, wie Nachrichten gemacht sind, lerne sie zu überprüfen und mir kritisch eine Meinung zu bilden. Das heißt aber auch, dass ich mich frage, was diese Nachrichten für mich persönlich bedeuten, wie ich mich dazu als Teil dieser Gesellschaft verhalte und was ich tun kann.
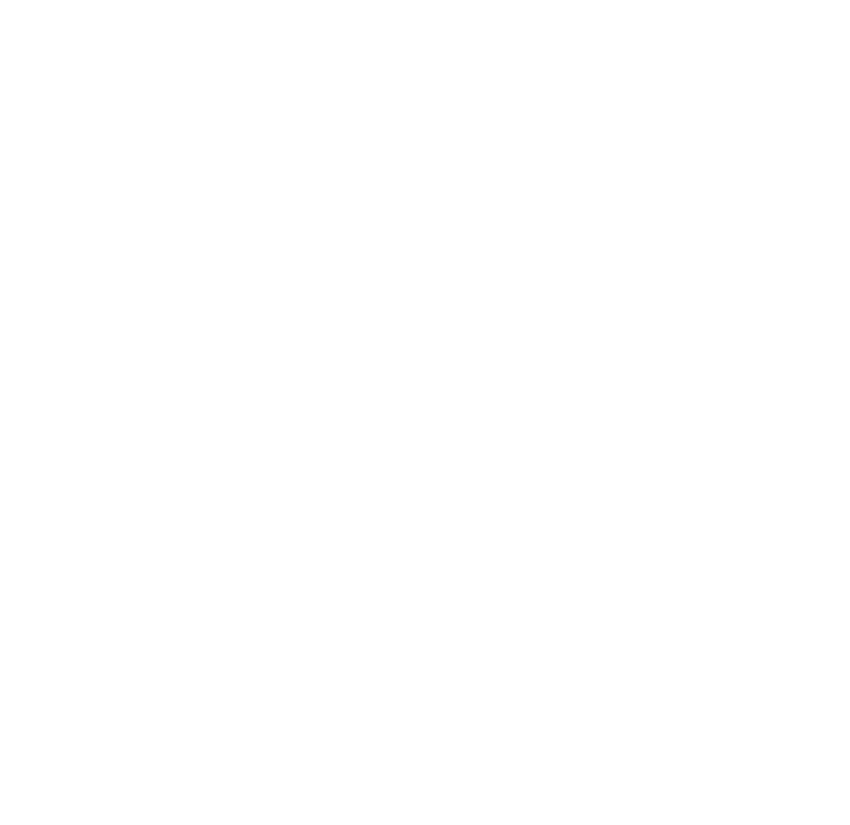
ARYA Das klingt ziemlich lebensnah. Kriegen die Jugendlichen da nicht Lust, echten Journalist*innen bei der Arbeit zuzusehen?
IRINA Mit den Teilnehmenden von „Newsroom“ lernen wir Medien auch ganz konkret kennen. Wir machen gemeinsam Exkursionen und waren beispielsweise im ARD-Hauptstadtstudio oder im RBB Crossmedialen Newscenter. Diese Orte, an denen die Nachrichten entstehen, live und in Person zu sehen, verändert natürlich auch ganz viel; diese Räume zu sehen, die Menschen dort kennenzulernen, die da arbeiten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich merke, dass das alleine bei mir schon verändert hat, dass ich jetzt immer, wenn ich eine Nachricht im Radio höre oder im Fernseher sehe, direkt ein ganz konkretes Bild dazu im Kopf habe.
Im Hauptstadtstudio oder im Newscenter haben wir auch gemerkt, wie viele Parallelen es zum Theater gibt. Nachrichten zu produzieren und zu verbreiten ist schlussendlich immer auch eine Art von Inszenierung und ebendas hinterfragen zu können, ist in unserer Welt, die nur so vollgestopft ist mit verschiedensten Nachrichten, total wichtig.
Im Hauptstadtstudio oder im Newscenter haben wir auch gemerkt, wie viele Parallelen es zum Theater gibt. Nachrichten zu produzieren und zu verbreiten ist schlussendlich immer auch eine Art von Inszenierung und ebendas hinterfragen zu können, ist in unserer Welt, die nur so vollgestopft ist mit verschiedensten Nachrichten, total wichtig.
- Das Wissen über die DDR schwindet – Deutsch-deutsche Geschichte im Unterricht (rbb24, Oda Tischewski, 11.11.2024)
- DDR-Geschichte – darum wissen Jugendliche wenig darüber (MOZ.de, Lisa Hör, 06.09.2024)
- DDR-Volksaufstand von 1953 nur unzureichend in der Erinnerungskultur verankert – Umfrage der Bundesstiftung Aufarbeitung zeigt Wissensdefizite bei jüngeren Menschen (Bundesstiftung Aufarbeitung, Pressemitteilung vom 12.06.2023)
Fotos: Pia Henkel, Ðôn Hoang